Die Soziale Angststörung: nicht Schüchternheit, sondern Störung von Krankheitswert
Einleitung
Die Soziale Angststörung (SAS) gehört zu den häufigsten und gleichzeitig am wenigsten beachteten Angststörungen. In Europa und den USA gilt sie als dritthäufigste psychische Störung hinter Depression und Alkoholabhängigkeit. Frauen sind von der SAS häufiger betroffen, aber Männer kommen eher in Behandlung. Aufgrund ihrer epidemiologischen Relevanz (Lebenszeitprävalenz bis zu 10%) und ihres invalidisierenden Charakters, wurde sie im DSM-IV von Sozialer Phobie in «Soziale Angststörung» (Social Anxiety Disorder) umbenannt. Die Störung wird oft übersehen, und Betroffene kommen erst wegen Folgeerkrankungen wie Depression und Sucht in Behandlung, nachdem sie psychosozial bereits massiv eingeschränkt sind. Dies mag verschiedene Gründe haben: So ist soziale Unsicherheit und Ängstlichkeit ein Alltagsphänomen, das auch von Fachleuten unterschätzt wird. Die SAS ist aber eine psychische Störung mit Krankheitswert. Mit modernen Antidepressiva und Verhaltenstherapie lässt sie sich gut behandeln, wobei die Kombination beider Verfahren die besten Ergebnisse erzielt. Aufgabe des Hausarztes ist es, eine SAS frühzeitig aufzudecken, organische Ursachen auszuschliessen, eine Behandlung einzuleiten und insbesondere bei Vorliegen komorbider Störungen die Überweisung zum Psychiater zu veranlassen.
Symptomatik und Verlauf
Die Diagnose kann nach den Kriterien von ICD-10 und DSM-IV erfolgen. Angstauslösend sind Situationen mit sozialer Exposition, in denen die Beobachtung und Bewertung durch andere erwartet wird. Betroffene haben Angst, etwas zu sagen oder zu tun, was peinlich sein könnte. Sie glauben, andere würden sie als inkompetent, schwach oder gar «gestört» beurteilen oder Symptome wie Zittern der Stimme, Tremor, Schwitzen, Nervosität bemerken und negativ bewerten. Es kann zu Erröten, Zittern, Übelkeit, Miktions- oder Defäkationsdrang und allen psychischen, körperlichen und vegetativen Symptomen der Angst und sogar zu Panikattacken kommen. Manchmal kann bereits der Gedanke an die gefürchtete Situation eine massive Angstsymptomatik provozieren. So werden diese Situationen gemieden, was die Betroffenen im Privaten wie im Beruflichen mehr und mehr einschränkt und bis zur sozialen Isolierung führt.
Bei der nicht-generalisierten Form sind die Ängste klar eingegrenzt: z.B. Sprechen in der Öffentlichkeit, Autoritätspersonen gegenübertreten, Personen des anderen Geschlechts ansprechen, Essen mit anderen Menschen, jemandem vorgestellt werden, beim Schreiben oder Telefonieren beobachtet werden, Besuch empfangen, in einem Lokal in der Mitte sitzen. Die Ängste können sich aber auch zu einer generalisierten SAS ausdehnen. Ein häufiges Phänomen ist die sog. «negative Suggestibilität», d.h. negative Informationen über sich selbst werden besser erinnert als positive Rückmeldungen. So kann ein einziges negatives Erlebnis eine Vielzahl positiver Erfahrungen neutralisieren. Bei Kindern zeigen sich soziale Ängste durch Schulphobie, Prüfungsangst und die Angst, ausgelacht zu werden.
Wie aus Abbildung 1 ersichtlich, tritt die Soziale Angststörung in der Adoleszenz auf, wobei oft eine Prodromalphase mit Schüchternheit und sozialer Gehemmtheit vorausgeht. 75% erkranken bis zum 21. Lebensjahr, ein Beginn nach 26 ist selten. Die SAS verläuft unbehandelt fluktuierend, neigt zur Progression und Chronifizierung und wird durch eine hohe Komorbiditätsrate (50-80%) kompliziert. Häufigste Folgeerkrankungen sind Depressionen, Alkoholabhängigkeit, andere Angststörungen, Drogen- und Medikamentenmissbrauch. Die SAS ist eine ernste Erkrankung mit potentiell schweren Folgen (siehe folgende Tabelle), woraus sich die Notwenigkeit einer frühen Diagnose und Therapie ergibt.
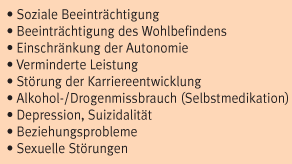
Ätiologie
Die SAS entsteht im Zusammenspiel einer genetisch bedingten Vulnerabilität mit psychosozialen Faktoren. Belastende Erlebnisse in Kindheit und Jugend, körperlicher oder sexueller Missbrauch, ängstliche Eltern und Überbehütung werden als psychosoziale Ursachen diskutiert. Es sind neurobiologische Dysfunktionen im serotonergen, noradrenergen, dopaminergen und GABAergen System sowie im Bereich der hypothalamisch-hypophysären-Nebennierenrinden-Achse gefunden worden. High-risk-Studien zeigen eine starke familiäre Transmission der Störung. Aufmerksamkeitsstudien zeigen Wahrnehmungsfehler für soziale Reize, welche übermässig beachtet und als bedrohlich eingestuft werden. Dies erklärt die Leistungsminderung bei Prüfungsangst. Wahrnehmungsverzerrungen in sozialen Interaktionen zeigen sich auch darin, dass Sozialphobiker Augenkontakt meiden.
Verbesserung der Diagnosesicherheit
Typisch für SAS-Betroffene ist der Versuch, ihre Erkrankung zu verbergen. So führen oft erst Verschlimmerungen der Angst, z.B. infolge einer Beförderung, die Betroffenen zum Arzt. In der Sprechstunde stehen dann fast immer die vegetativen körperlichen Beschwerden im Vordergrund, und die Angst wird kaum als zentrales Symptom erlebt und geschildert. Damit die SAS häufiger erkannt wird, empfiehlt die «International Consensus Group on Anxiety and Depression» die folgenden Screening-Fragen:
- 1. «Fühlen Sie sich unwohl oder gehemmt, wenn sie von anderen beobachtet werden?»
- 2. «Finden Sie es schwierig, mit anderen Menschen Kontakt zu pflegen?»
Folgende Befunde sollten für die Diagnose einer SAS sensibilisieren:
- Ängste und vegetative Symptome in sozialen Situationen
- Überempfindlichkeit gegenüber negativer Bewertung, geringes Selbstvertrauen, Schüchternheit
- Alkohol-/Medikamentenmissbrauch
- Depression
- Schul- und Prüfungsängste bei Jugendlichen
Differentialdiagnose
Die Differentialdiagnose beinhaltet sowohl den Ausschluss organischer Ursachen, als auch der Panikstörung, Agoraphobie, Depression, Dysmorphophobie, Persönlichkeitsstörungen (v.a. unsichere PS) und Psychosen. «Lampenfieber» und Schüchternheit sind von der SAS abzugrenzen. Nach ICD-10 wird Angst vor grossen Menschenmengen als normal angesehen. Eine soziophobische Entwicklung bei familiärem essenziellem Tremor bedarf einer besonderen Beachtung, da dieser spezifisch behandelt werden kann. Es hängt von Faktoren wie Leidensdruck, Einschränkung der Lebensqualität und Komplikationen ab, ob eine behandlungsbedürftige Erkrankung oder ein Persönlichkeitsmerkmal vorliegt.
Behandlung der SAS
Behandlungsziel ist die Remission, womit eine weitgehende Reduktion der Angst und eine normale soziale Lebensführung gemeint sind. Als Therapieoptionen stehen pharmakologische und psychotherapeutische Strategien zur Verfügung. Am Anfang steht eine umfassende Information des Patienten über das Wesen der Angst und ihrer Behandlung.
Pharmakotherapie
Eine adäquate Pharmakotherapie führt oft zu einer deutlichen Verbesserung der Lebensqualität. Es stehen verschiedene Medikamente zur Behandlung der SAS zur Verfügung: Siehe Tabelle 2
Substanzen aus der Gruppe der SSRIs und der SNRIs sind aufgrund ihrer guten Wirksamkeit und ihres günstigen Nebenwirkungsprofils Mittel erster Wahl. Bei Kindern sind die Warnhinweise der FDA (2003) für SSRI/SNRI zu beachten.
Lange galten Irreversible Monoaminooxidasehemmer als am wirksamsten in der Behandlung der SAS. Da sie aber schlechter verträglich sind, einer Diät bedürfen und das Risiko einer hypertensiven Krise bergen, werden sie nur noch bei Therapieresistenz als Option geführt. Trizyklische Antidepressiva haben keine Wirkung bei der SAS.
Die Benzodiazepine wie Clonazepam und Bromazepam sind wirksam und werden am Anfang der Behandlung häufig eingesetzt, sind aber in der Langzeitbehandlung nur von sekundärer Bedeutung. Die Stellung von Gabapentin und anderen Antiepileptika in der Behandlung der SAS ist noch unklar. Betablocker sind nur bei der nicht-generalisierten Form der SAS hilfreich, insbesondere bei Lampenfieber in Leistungssituationen (z.B. Examensangst).
Psychotherapie
Die wirksamste psychotherapeutische Strategie zur Behandlung der SAS im langfristigen Verlauf ist der Einsatz kognitiv-verhaltenstherapeutischer Elemente, insbesondere die Exposition gegenüber der gefürchteten Situation und die kognitive Umstrukturierung. Wenn nötig, werden auch soziale Kompetenzen trainiert und Selbsthilfemassnahmen (Entspannungsübungen, etc.) vermittelt.
Dr. med. Josef Hättenschwiler, Psychiatrische Universitätsklinik, Zürich, Dr. med. Daniele F. Zullino, Département Universitaire de Psychiatrie Adulte, Prilly-Lausanne
Weitere Infos zu Angst und Depression für Fachleute und Betroffene: www.swissanxiety.ch.
|